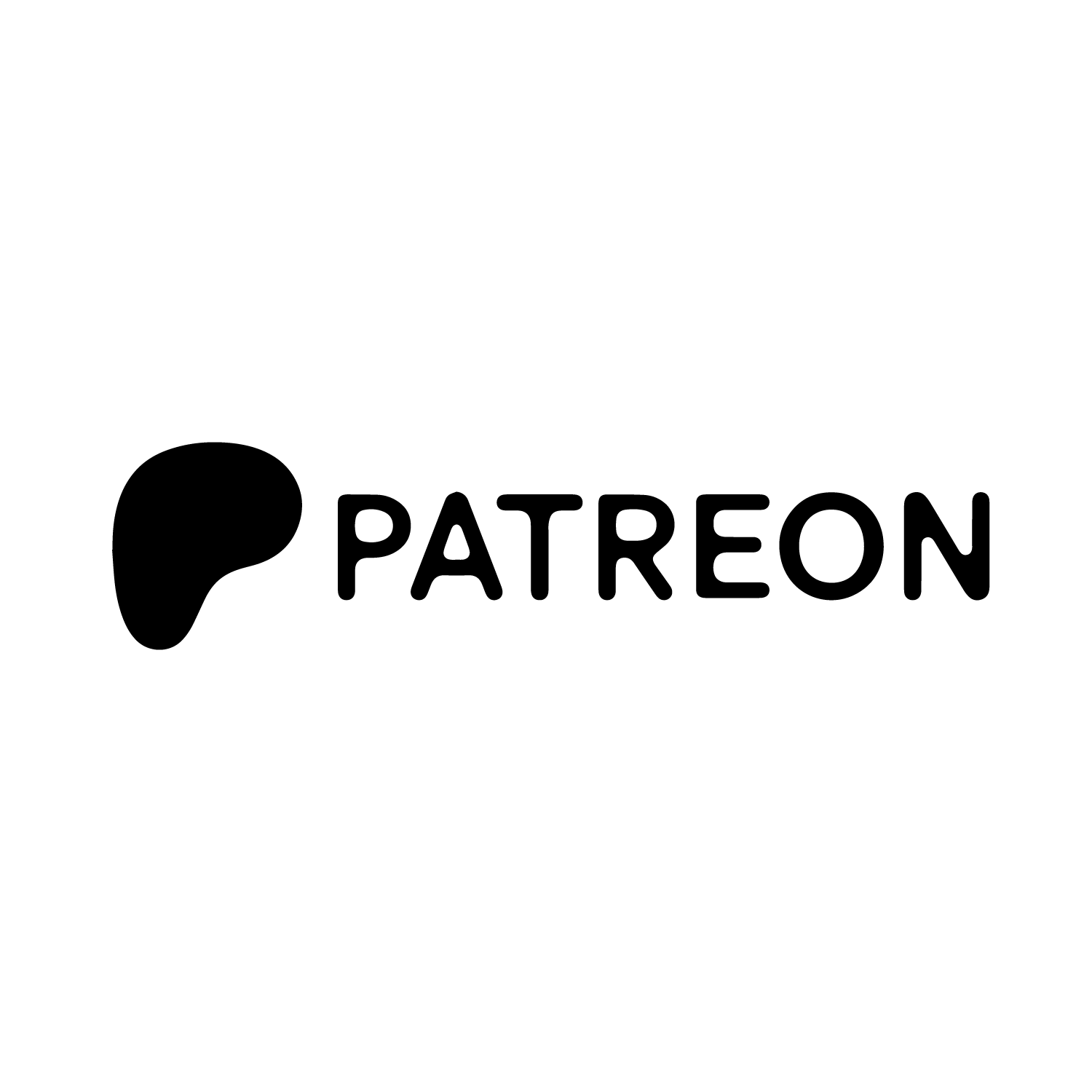Heilung durch Zuhören: Die Kraft der Aufmerksamkeit im Gesundheitssystem
Aufmerksames Zuhören erfodert echte Neugier und Interesse für die Patientin und bringt im medizinischen Umfeld Vorteile für Personal und Patienten.
Zuhören ist für Ärztinnen und Ärzte an der Tagesordnung und der erste Schritt zu jeder Behandlung. Trotzdem wird aufmerksames Zuhören in Praxen und Kliniken zunehmend zur Mangelware, wie ein Kommentar in der Fachzeitschrift Mayo Clinic Proceedings mahnt. Die Terminkalender sind bereits überfüllt, andere Patientinnen und Patienten warten, das Computersystem muss mit Daten gefüllt werden und die Gespräche verkürzen sich. Dabei ist “werteorientiertes Zuhören” ein entscheidender Schlüssel für gute medizinische Resultate, wie die Autorinnen und Autoren in der Fachzeitschrift schreiben.
Sie beschreiben einen konkreten Fall von einem zurückgezogenen und für das Personal anstrengendem Patienten in einem Pflegeheim. Eines Tages fragte ihn eine Pflegerin beim Vorbereiten seines Bads, was für ihn einen guten Tag ausmachen würde. “Ich möchte mein blaues Hemd tragen”, antwortete er. Auf die Nachfrage der Pflegerin erzählte der ältere Mann, dass das blaue Kleidungsstück das Lieblingshemd seiner verstorbenen Frau war. Während des Bads erzählte er, wie er seine Frau kennengelernt hatte, wie sie gemeinsam lebten und was sie ihm bedeutete. Nach dem Bad bat er um einen Rollstuhl, um den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims von seiner Frau erzählen zu können. Es war das erste Mal, dass er von sich aus Kontakt zu anderen suchte und von seinem Leben erzählte.
Das Beispiel für “echtes, neugieriges Zuhören” zeige, dass schon einfache, offene Fragen den Raum für Antworten öffnen können. Die Pflegerin zeigte Interesse, nahm den Patienten ernst, konnte Vertrauen aufbauen und so eine bisher verschlossene Tür öffnen.
Gespräche auf Augenhöhe, mit Neugier und Vertrauen
Im Kommentar zum aufmerksamen Zuhören werden sechs praxisnahe Ansätze gelistet, um das zu erreichen:
Nähe: Gerade in Kliniken sollten Ärztinnen und Ärzte nicht nur “rasch vorbeischauen” und wieder gehen, sondern wirklich beim Patienten verweilen. Befragungen haben gezeigt, dass Chirurginnen oder Pfleger, die sich zu den Patienten hinsetzen, als fürsorglicher, höflicher und besser informiert bewertet werden. Sie werden als Personen wahrgenommen, die sich mehr Zeit genommen haben.
Neugierde zeigen: Offene Fragen laden dazu ein, mehr zu erzählen. Wird den Patienten oder Familienmitgliedern Raum für Antworten geboten, könne das manchmal bei der Diagnose entscheidend helfen. Beim neugierigen Zuhören sind auch Körpersignale entscheidend, die Expertinnen und Experten empfehlen, sich auf Augenhöhe hinzusetzen, bei der Erzählung zu nicken und Augenkontakt zu halten. Auch spezifische Fragen können hilfreich sein. “Welche Fragen haben Sie an mich?” statt “Haben Sie noch Fragen?”. Oder eben “Was würde diesen Tag für Sie gut machen?” statt “Geht es Ihnen gut?”.
Vertrauen aufbauen: Aktives Zuhören ohne Unterbrechungen und einfühlsame Reaktionen können das Vertrauen bei Patienten stärken. Es dürfe nicht nur darum gehen, welche gesundheitlichen Probleme der Patient habe und wie er geheilt werden kann. Fachpersonen sollten die Bedürfnisse und Sorgen der Patienten verstehen. Dabei gehe es in Gesprächen auch darum, auf die Emotionen zu achten und diese zu benennen. “Ich sehe, dass das belastend für Sie ist”, kann für einen Patienten viel bedeuten. Im Kommentar werden auch Experimente mit KI-Tools als Unterstützung erwähnt. So testen einige Ärztinnen und Ärzte ein System, welches Gespräche in Echtzeit dokumentiert. So können sich die Fachpersonen voll der Interaktion mit den Patienten widmen, anstatt, wie heutzutage oft üblich, alle Informationen selber einzutippen und dem Computer statt dem Menschen zugewandt zu sein.
Der Patientin zugewandt statt dem Computer: Was heute seltener geworden ist, würde die Behandlung für beide Seiten verbessern. KI-Tools könnten dabei helfen.
Räume gestalten: Gerade in Kliniken sollen störungsfreie Gespräche gefördert werden. Ein Stuhl neben dem Patientenbett führe bereits dazu, dass sich Ärztinnen und Ärzte für Gespräche eher hinsetzen, als neben dem Bett zu stehen. Auch bessere Schallschutzmassnahmen sollten geprüft werden, beispielsweise Glastrennwände statt Vorhänge zwischen Patienten. Und in Alaska hat eine Klinik spezielle “Gesprächs-Räume” eingerichtet, heisst es im Kommentar, also separate Zimmer, mit gemütlicher Einrichtung, wo sich Patienten wohler fühlen.
Teams stärken: Dabei geht es darum, Entscheidungen nicht “top down”, also von oben herab zu diktieren, sondern alle Ideen ernst zu nehmen. Gerade Pflegekräfte, die eng bei den Patienten sind, machen andere Beobachtungen als Führungskräfte oder Ärztinnen. Werden sie frühzeitig einbezogen, können sie ihre Sichtweisen einbringen und praxisnahe, oft sofort umsetzbare Lösungen vorschlagen. In Hawaii hat ein Programm namens “Getting Rid of Stupid Stuff” innert zwei Jahren zu 500 Verbesserungsvorschlägen geführt. Führungskräfte sollen zudem ihre Teams würdigen, Verantwortung delegieren und Entscheidungswege verkürzen.
Resilienz fördern: Spitäler und Heime sollen ihre Teams fördern und unterstützen. Das können regelmässige kurze oder längere Sitzungen für den Austausch sein, um Belastungen zu teilen. Bewährt habe sich in diesem Kontext ein gemeinsames Essen, da Gesundheitsfachkräfte sich oft kaum Zeit für das Essen nehmen. Zwei Studien haben gezeigt, dass gemeinsame Mahlzeiten den Austausch fördern und die Resilienz steigern. Zudem werde die Arbeit und der Arbeitgeber positiver bewertet und Burnout-Raten sinken.
Fazit: Patienten und Personal profitieren vom aufmerksamen Zuhören
Die Forschung zeigt, betonen die Autorinnen und Autoren in ihrem Kommentar, dass aufmerksames Zuhören mit Neugier, körperlicher Präsenz und Mitgefühl nicht einfach ein “Nice-to-have” sei, sondern eine zentrale Arbeit von medizinischen Fachkräften.
Wer die Gesprächszeit mit seinen Patientinnen und Patienten kürzt, um mehr Termine unterzubringen, begeht demnach eine “falsche Ökonomie“: Kurzfristig mag der Kalender voller wirken und mehr Profit versprechen, langfristig aber leidet das Vertrauen, was Folgen für Therapieerfolg, Patientenzufriedenheit und Arbeitsbelastung hat.
Mehr Zeit und werteorientiertes Zuhören stärkt und verbessert hingegen das Gesundheitssystem, sowohl für Patienten wie auch das Personal. Beide Seiten profitieren von besseren Beziehungen, mehr Zufriedenheit und höherer Versorgungsqualität.
Quelle: Mayo Clinic Proceedings