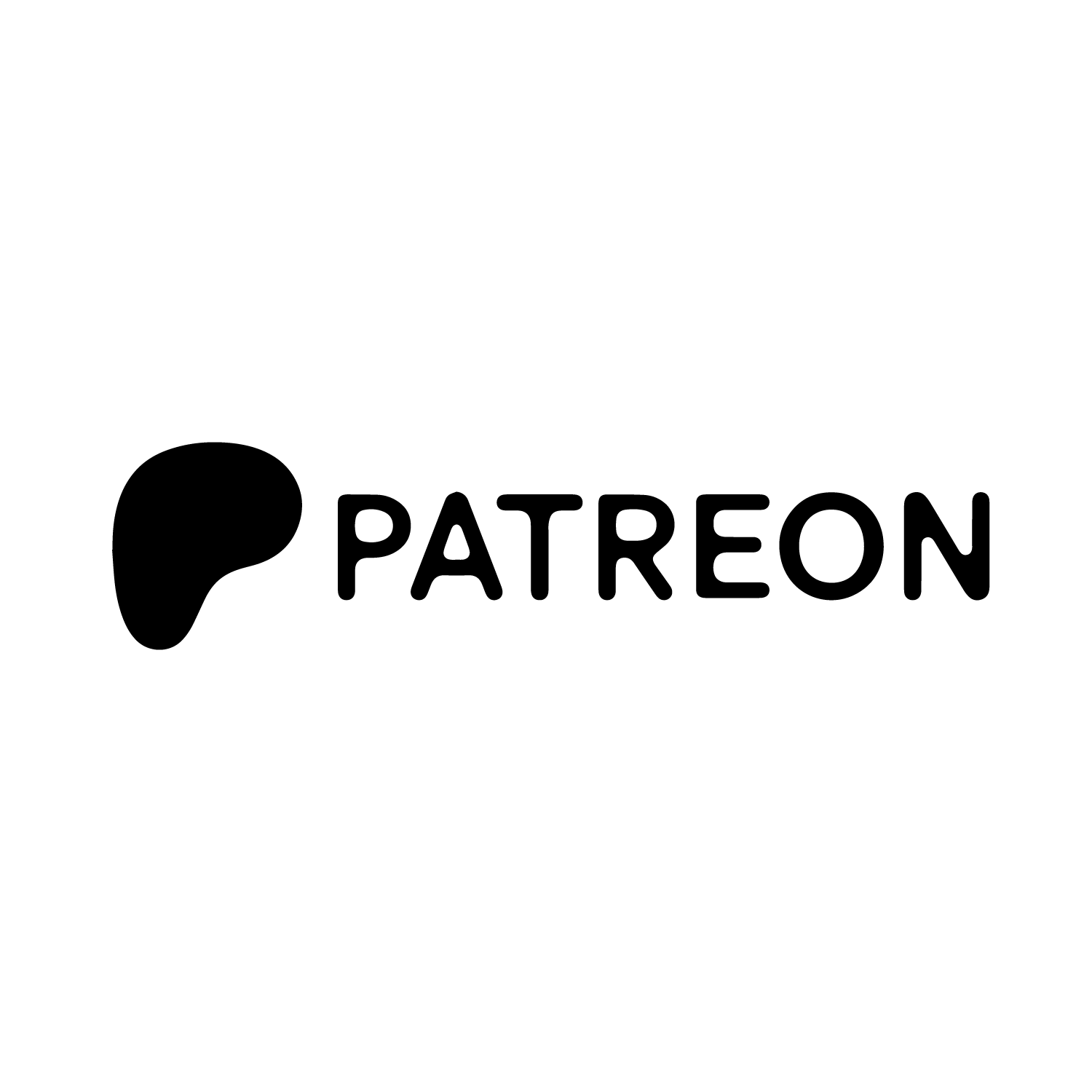Umsiedlung auf Bombentestgelände rettet gefährdete Specht-Population
Studienautor Alex Lewanski lässt einen markierten Rothaubenspecht frei: Mit dem Umsiedlungs-Projekt hat sich die Population erholt. Foto: Michigan State University
Auf den ersten Blick ist das militärische Trainingsgelände Avon Park Air Force Range in Florida kein Ort, an dem man hoffnungsvolle Geschichten über neues Leben erwarten würde. Es handelt sich um den grössten Bomben- und Schiessübungsplatz im Osten der USA, der von allen Streitkräften aktiv genutzt wird. Ein Teil der Anlage ist aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich, beispielsweise fürs Fischen, Wandern oder Jagen. Und auch die Natur floriert auf der 429km2 grossen Fläche südlich von Orlando.
Hier haben gefährdete Rothaubenspechte eine zweite Chance erhalten und offenbar genutzt. Forschende der Michigan State University beschreiben das Umsiedlungs-Programm in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences.
Die Resultate lassen aus zwei Gründen aufhorchen. Einerseits hat die militärische Nutzung des Geländes positive Effekte für die Spechte. Diese leben in lichten Kiefernwälder, wobei gelegentliche Brände durch Bombentests genau diesen Lebensraum erhalten. Andererseits zeigt das Projekt, wie anderen gefährdeten Populationen geholfen werden könnte.
Die umgesiedelten Jungspechte haben die Population stabilisiert
Die Forschenden der Michigan State University haben zwischen 1998 und 2016 junge Rothaubenspechte in das Bombentestgelände umgesiedelt. Die 54 Jungtiere stammten aus anderen Schutzgebieten in Florida oder Georgia, wo einzelne Tiere entnommen werden konnten, ohne die Population zu gefährden. Von den Neulingen überlebten rund 70 Prozent und paarten sich mit bereits ansässigen Rothaubenspechten. Das Umsiedlungsprogramm hat somit die genetische Vielfalt erhöht, aber auch die Brutaktivität. Die umgesiedelten Jung-Spechte besetzten meist die besten Nistplätze und konnten sofort zur Reproduktion beitragen. Über die Lebensspanne eines Vogels beobachteten die Forscherinnen und Forscher mehr Nachkommen, wobei auch diese wiederum erfolgreicher brüteten als lange ansässige Artgenossen. Manche Vögel gründeten regelrechte Specht-Dynastien.
Neben der Umsiedlung kümmerten sich die Forschenden auch um eine optimale Lebensgrundlage. Mit kontrollierten Brände schuffen sie die Grundlage für neue, lichte Kiefernflächen. Gleichzeitig schützten sie Bereiche mit alten Bäumen, in deren weichem Holz die Spechte ihre Bruthöhlen zimmern können.
Solche Langzeitbeobachtungen von einzelnen Tieren und ihren Nachkommen über fast 30 Jahre sind in Artenschutzprojekten selten und deshalb besonders wertvoll. Die Forschenden sehen das Projekt als wichtigen Beitrag, um gefährdete Arten gezielt und erfolgreich erhalten zu können. Solche Umsiedlungen seien dafür wohl eine der besten Strategien. “Es hat das Potenzial, eine wichtige Grundlage für das Schutzmanagement vieler gefährdeter Arten zu sein“, sagt Studien-Autor Alex Lewanski.
Der Rothaubenspecht, einst in den ganzen USA beheimatet, gilt mittlerweile nicht mehr als vom Aussterben bedroht, sondern nur noch als gefährdet. Und die Forschenden sind hoffnungsvoll, dass das schnelle Hämmern ihrer Schnäbel auf der Avon Park Air Force Range noch lange zu hören sein wird.